
Medien &
Presse
Finde Pressemitteilungen, Pressefotos, Pressespiegel sowie die wichtigsten Publikationen im Überblick.
Du hast spezielle Fragen oder benötigst weitere Informationen für dein Medium? Nimm einfach Kontakt mit uns auf.
TeamBank Mediencenter
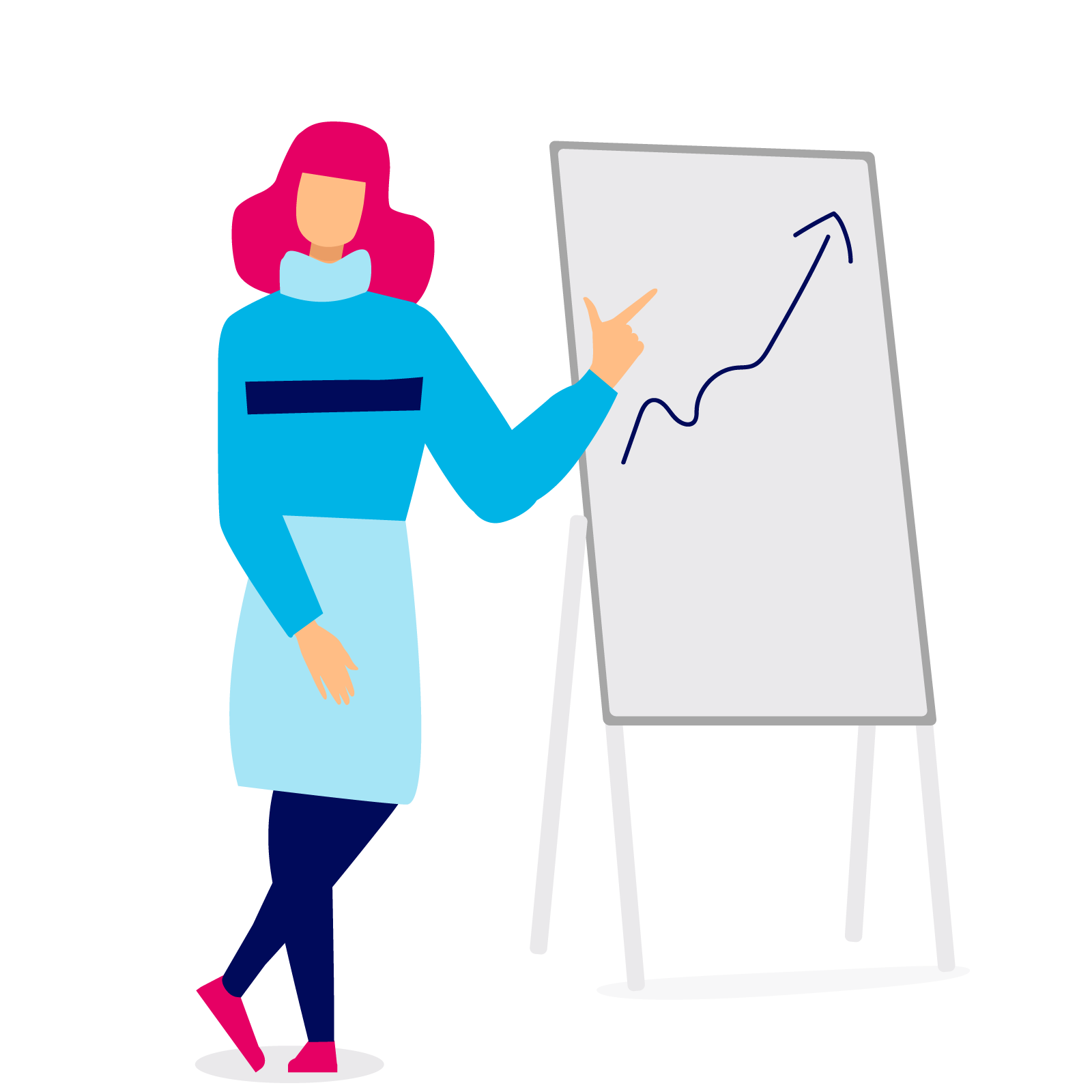
Studie Liquiditätsbarometer 2024
Medienkontakte TeamBank

Ute Scharnagl
Pressesprecherin TeamBank AG und easyCredit
Telefon: +49 911/ 53 90 – 32 02 E-Mail: ute.scharnagl@teambank.de
Marc-Olivier Weber
Pressesprecher TeamBank AG
Telefon: +49 911/ 53 90 – 12 45 E-Mail: marc-olivier.weber@teambank.de
Manuel Mazoll
Pressesprecher TeamBank AG
Telefon: +49 911/ 53 90 – 10 63 E-Mail: manuel.mazoll@teambank.de
Michaela Schubert
Pressesprecherin easyCredit-Ratenkauf
Telefon: +49 911/ 53 90 – 39 72 E-Mail: michaela.schubert@teambank.de
Tamara Schwab
Pressesprecherin Nachhaltigkeit
Telefon: +49 911/ 53 90 – 29 61 E-Mail: tamara.schwab@teambank.de